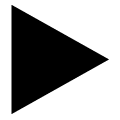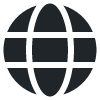Artikel Beziehungen zu Österreich ehemals Vertriebener
Zwischen Gugelhupf und Hakenkreuzfahnen
Beziehungen zu Österreich vertriebener ÖsterreicherInnen und deren Nachkommen in Israel
Ziel meines Forschungsaufenthaltes in Israel war es, mittels Interviews mit im Nationalsozialismus vertriebenen Jüdinnen und Juden sowie deren Kindern und Enkelkindern herauszufinden, wie sie heute zu Österreich stehen und welche Gefühle sie heute mit diesem Land verbinden. Pflegen die Überlebenden des Nationalsozialismus Kontakte zur ehemaligen Heimat Österreich, besuchen sie den ehemaligen Wohnort, verwenden sie die deutsche Sprache in ihren Familien in Israel und wo fühlen sie sich heute, über 70 Jahre nach ihrer Flucht, zu Hause? Haben ihre Kinder und Enkel Interesse an der Herkunft der Familie und gibt es Anteile an der eigenen Persönlichkeit, die sie als Österreichisch einstufen, obwohl sie in Israel geboren und aufgewachsen sind?
Schließlich führte ich innerhalb von drei Monaten insgesamt 35 Interviews in Israel durch: 25 mit österreichisch-jüdischen Überlebenden, geboren zwischen 1917 und 1937, sechs Interviews mit Kindern von Überlebenden und 4 mit Enkelkindern. Aus diesen Gesprächen lassen sich zentrale Tendenzen ihrer Beziehung zu Österreich ableiten.
Kindheit und Jugend in Österreich vor 1938
Ein Großteil meiner österreichischen InterviewpartnerInnen stammte aus wenig religiösen Elternhäusern, in denen der jüdischen Religion gar keine bis eine mäßige Rolle zukam. Einige von ihnen wuchsen in zionistischen Familien auf und waren teilweise bereits als Kinder in entsprechenden Vereinen aktiv. Die Zuwendung zum Zionismus entstand oftmals aufgrund antisemitischer Erlebnisse, so wie etwa bei Jehuda Walter S.:
„Ich war früher nicht, nicht meine Eltern, nicht mein Großvater, keine Zionisten. Aber durch Zwang wurden wir Zionisten. Ich sag immer ich bin Zwangszionist.“
Die Erinnerungen an die Kindheit und Jugend in Österreich sind ambivalent. Es wechseln Erinnerungen, die mit positiven Gefühlen einhergehen: Abende beim Heurigen, Ausflüge aufs Land, Besuche im Kaffeehaus mit dem Vater, Mohnnudeln essen und Theaterbesuche. Diese werden überlagert von negativen Erinnerungen, die oftmals traumatischen Charakter haben: Anpöbelungen und Beleidigungen auf der Straße, Massenansammlungen beim „Anschluss“ 1938, die Verhaftung des Vaters und ähnliches. Insbesondere die letzte Zeit vor der Flucht ist geprägt von schockierenden Erlebnissen, wie etwa Norbert K. berichtet:
„Auf der Straße war das Leben unmöglich, ja. (…) ältere Leute über 60 haben geschrubbt die Straßen (…). Und die Bevölkerung ist dort gestanden und hat gelacht. Und was uns fürchterlich getroffen hat, war die Tatsache, dass Leute mit denen du früher verkehrt hast, die du gekannt hast, in deinem Haus gelebt haben, plötzlich bist du Luft für sie gewesen, im besten Fall. Und sie haben dich beschimpft.“
Schwieriger Neubeginn
Die Jahre nach der gelungenen Flucht nach Palästina waren geprägt von existentiellen Problemen und Sorgen um Familienmitglieder, die man zurücklassen musste. Alle der von mir Befragten waren zum Zeitpunkt ihrer Flucht jünger als 22 Jahre. Unter schwierigsten Bedingungen gelang es ihnen, sich ein neues Leben in einer völlig fremden Umgebung aufzubauen, beruflich wie privat Fuß zu fassen und Hebräisch zu lernen. Jene, die in einem Kibbuz oder Moschav lebten, fanden erleichterte Startbedingungen vor, hatten sie doch in den anderen Mitgliedern, die oft ein ähnliches Schicksal teilten, so etwas wie eine Ersatzfamilie gefunden. Oft vergingen Jahre, bis meine InterviewpartnerInnen Gewissheit über den Verbleib ihrer Familienangehörigen bekamen. Nur bei 9 von 25 Befragten überlebten sowohl die Eltern als auch alle Geschwister, die anderen Familien wurden durch die Nationalsozialisten zerrissen.
Inwieweit die österreichische Herkunftskultur im Leben der Geflüchteten eine zentrale Rolle spielte, zeigt deren Partnerwahl. 16 von 25 Befragten heirateten eine/n PartnerIn mit einem ähnlichen kulturellen Hintergrund, wie etwa auch Frau G.:
„Und meine verschiedenen Verehrer die ich hatte, bevor ich ihn kennen gelernt habe[ihren Mann, der aus Österreich kommt, Anm.d.Verfass.], waren alles Sabres. Also natürlich hiesige schon. (…) Und irgendwie hat es nie geklappt (…). Wenn ich heute zurück denke, weil mich eben die Mentalität nicht genug angezogen hat. Und in dem Moment wo ich ihn kennen gelernt hab, da hat´s sofort geklappt.“
Die Verwendung der deutschen Sprache ist heute wohl das deutlichste Zeichen der österreichischen Herkunft der ehemals Vertriebenen. Bis auf zwei Personen gaben alle an, bis heute regelmäßig Deutsch zu sprechen, sei es mit Freunden und Bekannten und oft auch mit dem Partner oder der Partnerin:
„Wenn man sich lieb hat oder wenn man streitet kann man das nicht auf Hebräisch.“
Rund die Hälfte der Kinder der Überlebenden spricht Deutsch, jedoch nur ganz wenige Enkelkinder. Vielen in der Nachkriegszeit aufgewachsenen Kindern wurde das Erlernen der deutschen Sprache vorenthalten. Es galt sich als Sabres zu zeigen, die deutsche Herkunft hinter sich zu lassen, zumindest in der Öffentlichkeit. So wurde die deutsche Sprache in die eigenen vier Wände verdrängt.
Zurück nach Österreich?
Eine Rückkehr nach Österreich kam für die durch die Nationalsozialisten Vertriebenen nicht in Frage. Die Vorstellung, wieder unter jenen Menschen zu leben, die einen der Vernichtung zuführen wollten, war undenkbar. Viele nahmen sich sogar vor, Österreich nie wieder zu betreten, die meisten brachen jedoch diesen Vorsatz. Die Motive für den ersten Besuch in der früheren Heimat waren unterschiedlich: Etwa die Hälfte der Vertriebenen hatte Verwandte oder Freunde in Österreich, die besucht wurden, andere verspürten schlicht und einfach Heimweh oder wollten ihrem Partner ihr Herkunftsland zeigen. Interessanterweise gaben fünf Personen an, nicht gezielt nach Österreich gereist zu sein, sondern nur einen kurzen Abstecher bei einer Reise in ein anderes Land dorthin gemacht zu haben, etwa einen Zwischenstopp bei der Rückreise. Diese Leute gehören zu jener Gruppe von Vertriebenen, die heute, nach mehreren Besuchen in Österreich noch immer nicht ohne ein ungutes Gefühl im Bauch in ihr Geburtsland reisen. Drei Personen betraten Österreich erstmals wieder als sie offiziell eingeladen wurden, sei es als vertriebene/r ÖsterreicherInn oder als KonferenzteilnehmerIn. Während manche bis heute sagen, sie sähen keinen Grund Österreich abgesehen von beruflichen Terminen zu besuchen, verbringen andere seit Jahrzehnten alljährlich ihren Urlaub hier. Der Umgang mit den schmerzvollen Erinnerungen ist demnach sehr unterschiedlich.
Auch die Gefühlslage der Überlebenden bei Aufenthalten in Österreich variiert von schlecht über ambivalent bis hin zu sehr gut. Gerda H. erklärte ihre ambivalenten Gefühle bei Österreich-Besuchen folgendermaßen:
„Ich fühl mich in Wien absolut schizophren. Ich geh irgendwo spazieren, da war ich als Kind, im Volksgarten gespielt, da hab ich das erste Rendezvous gehabt und da bin ich davongelaufen, weil die Nazis die Juden gefangen haben die Straße zu reiben. Ich komm von einer Stimmung in die andere. Ja, ich bin in keiner richtig. In Wien bin ich immer so nervös, ich bin froh wenn ich wieder weg fahren kann. Obzwar ich mich ganz wohl fühl.“
Manche gaben an, sich in Österreich schlecht zu fühlen und zwar gerade deswegen, weil sie sich so gut fühlten und das mit ihrem Gewissen schwer vereinbaren könnten.
Die nachfolgenden Generationen
Spricht man mit den ehemals Vertriebenen über die Beziehung ihrer Kinder und Enkel zu Österreich, so ergibt sich ein interessantes Bild: Beinahe alle sind der Meinung, ihre Kinder ein Stück weit österreichisch erzogen zu haben. Beispielhaft genannt wurden der österreichische Humor, die österreichische Küche und das gute Benehmen. Sie glauben, ihre Kinder seien sehr wohl an Österreich interessiert, jedoch nur zwei Personen vermuten bei ihnen eine tiefere Bindung zu diesem Land. Immer wieder hörte ich von meinen InterviewpartnernInnen, die Enkel würden größeres Interesse an der Vergangenheit zeigen, als dies bei den eigenen Kindern der Fall war. Enkel stellen Fragen, sie haben einen Wissensdurst und durch die größere Distanz zur Vergangenheit keine Hemmungen auch die negativen Erinnerungen anzusprechen. Dies hatten die Kinder von Vertriebenen, aufgewachsen inmitten der Trauer ihrer Eltern um die Verluste, nicht gewagt. Zudem wuchsen die Kinder der Vertriebenen in einer Zeit auf, in der auch in Israel kaum über die Vergangenheit gesprochen wurde. Alle Kräfte wurden in den Aufbau des Landes investiert, das Geschehene sollte verdrängt werden, der Holocaust war bis zum Eichmann Prozess 1962 absolut kein öffentlich diskutiertes Thema.
Fast alle der von mir befragten Kinder und Enkelkinder der Überlebenden des Nationalsozialismus waren bereits in Österreich, viele von ihnen mehrmals. In manchen Familien gehören gemeinsame Reise ins Herkunftsland sogar zur alljährlichen Tradition. Für die Überlebenden ist es von großer Bedeutung ihren Kindern und Enkeln zu zeigen, woher sie stammen, ihnen ein Stück weit die österreichische Kultur und das österreichische Leben zu vermitteln. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese gemeinsamen Besuche mehrerer Generationen in Österreich von großer Bedeutung für die gesamte Familie der Vertriebenen sind. Mit ihnen schließt sich ein Kreis, eine Verbindung zu Österreich wird hergestellt und die Beziehung zwischen den Generationen kann gestärkt werden, indem man sich gemeinsam mit der Vergangenheit beschäftigt.
Heimat – wo ist das?
Die Frage nach der Heimat, über 70 Jahre nach der Flucht aus Österreich, ist für viele bis heute schwierig zu beantworten. Während manche ganz klar Israel als Heimat nennen, als jenes Land in dem sie eine Familie gründeten und sich eine Existenz aufbauen konnten, haben andere ambivalente Heimatgefühle. Das Ehepaar J. antwortete auf meine Frage, wo heute ihre Heimat wäre:
„(…) nirgends. Wir sind entwurzelt, jeder von seiner Heimat. Auch hier [in Israel, Anm.d.Verfass.] sind wir nicht zu Haus. Das ist vielleicht eine Schande zu erzählen, aber es ist die Wahrheit.“
Vor allem die Sehnsucht nach der österreichischen Kultur, dem Essen, der Landschaft und Natur begleitet viele der Vertriebenen in ihrem Alltag in Israel. Viele gaben in den Gesprächen mit mir an, nach wie vor hauptsächlich ehemalige ÖsterreicherInnen oder EuropäerInnen in ihrem Bekanntenkreis zu haben und noch immer die deutsche Kultur zu leben, sei es mittels deutscher Bücher oder beim Kochen. Israel ist manchen von ihnen auch nach über 60 Jahren noch fremd:
„(…) wir können hier nicht verwurzelt sein, weil die Wurzeln nicht hier sind.“
Doch warum ist die Herkunft heute noch von so großer Bedeutung für sie? Diese Frage beantwortete mir Schaul B. völlig nachvollziehbar folgendermaßen:
„Seine erste Liebe vergisst man nicht!“[1]
Die Forschungsergebnisse im Detail liegen als Buch vor:
Nadja Danglmaier: „Seine erste Liebe vergisst man nicht…“ Vom Heimatgefühl aus Österreich vertriebener Jüdinnen und Juden und deren Nachkommen in Israel. Kitab Verlag, Klagenfurt 2009.
Nadja Danglmaier, geboren 1982, Mag. Dr.,ist Netzwerkkoordinatorin für Kärnten des Projekts „Nationalsozialismus und Holocaust: Gedächtnis und Gegenwart“ des bm:ukk (www.erinnern.at) und Vorstandsmitglied des Vereins Memorial Kärnten/Koroška sowie der Österreichisch-Israelischen Gesellschaft Kärnten. Als freiberufliche Pädagogin ist sie unter anderem als externe Lehrbeauftragte an der Universität Klagenfurt tätig und begleitet Gruppen bei Stadtrundgängen über den Nationalsozialismus in Klagenfurt und zu den ehemaligen KZs am Loibl-Pass.
[1] Alle Zitate stammen aus den von Nadja Danglmaier in Israel geführten Interviews, Interviewtranskripitonen im Privatarchiv der Autorin.