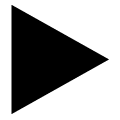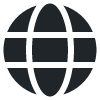Digitale Erinnerungslandschaft (DERLA) Salzburg
Das Dokumentations- und Vermittlungsprojekt DERLA (Digitale Erinnerungslandschaft Österreich) wurde im Jahr 2019 vom Centrum für Jüdische Studien, dem Zentrum für Informationsmodellierung und dem Arbeitsbereich Geschichtsdidaktik der Universität Graz sowie von ERINNERN:AT initiiert und erfasst sämtliche Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum für die Opfer des nationalsozialistischen Terrors in Österreich. Bei diesen Erinnerungszeichen handelt es sich um Denkmäler, Mahnmale, Stolpersteine, Gedenktafeln, Gräber sowie Straßen und Plätze, die auf der DERLA-Website dokumentiert sind. Der Internetauftritt des Projekts bietet weiters ausführliche Opferbiografien sowie ein kompetenzorientiertes Vermittlungsprogramm für Lehrkräfte sowie Schüler*innen. Darüber hinaus finden Besucher*innen der Projektwebsite ausgearbeitete Routen – sogenannte Wege der Erinnerung – entlang diverser Erinnerungszeichen, die es ermöglichen, diese Orte gehend zu erleben.
Zur Digitalen Erinnerungslandschaft: www.erinnerungslandschaft.at
Zwischen September 2023 und Dezember 2024 arbeitete ein wissenschaftliches Team der Paris Lodron Universität Salzburg unter der Leitung von Johannes Dafinger und Robert Obermair (Projektmitarbeiter*innen Eva Bammer, Cassandra Burgstaller, Julia Brunner, Marlene Horejs und Hasan Softić) an der Dokumentation der Erinnerungszeichen im Bundesland Salzburg. Insgesamt konnten so rund 782 Erinnerungszeichen erhoben sowie über 770 Opferbiografien dokumentiert werden.
Erinnerungszeichen im Bundesland Salzburg
Bei den Opfern, denen auf den Salzburger Erinnerungszeichen gedacht wird, handelt es sich um Salzburger Juden und Jüdinnen, Menschen mit Erkrankungen bzw. Beeinträchtigungen, die der NS-„Euthanasie“ zum Opfer fielen, sowie Widerstandskämpfer *innen sämtlicher Couleur, wobei solche aus dem sozialdemokratischen, sozialistischen bzw. kommunistischen Milieu überdurchschnittlich vertreten sind. Weiters finden sich unter den Opfern Mitglieder der Vaterländischen Front sowie im Allgemeinen Anhänger*innen des austrofaschistischen Regimes, Homosexuelle, Zwangsarbeiter*innen, Roma/Romnja und Sinti/Sintizze, Zeugen Jehovas, Deserteure sowie sogenannte „Asoziale“.
Eine Auswertung der Mahn- und Denkmale, Straßennamen, Stolpersteine, Gedenktafeln, Skulpturen sowie Gräber und Grabanlagen im Bundesland Salzburg zeigt, dass sich mehr als drei Viertel der Erinnerungszeichen (insg. 603) in der Stadt Salzburg befinden, wovon der größte Teil, insgesamt 517, auf die von Künstler Gunter Demnig verlegten Stolpersteine entfällt. Der Bezirk mit den aktuell wenigsten Erinnerungszeichen ist der Lungau; hier wurden zwischen 1945 und 2024 insgesamt sieben Gedenkzeichen umgesetzt. Die restlichen Erinnerungszeichen im Bundesland entfallen zu ungefähr gleichen Teilen auf die Bezirke Flachgau (42 Erinnerungszeichen), Tennengau (45), Pinzgau (31) und Pongau (54).
Chronologie der Erinnerung
Analysiert man den Entstehungszeitpunkt aller Erinnerungszeichen im Land Salzburg, fällt auf, dass ein Gros nach dem Jahr 2000 errichtet wurde. Davor initiierten Gemeinden, Organisationen sowie Privatpersonen einzelne Gedenkzeichen, zwischen 1945 und 1985 hielt sich die Errichtung dieser jedoch allgemein in Grenzen. Einen ersten Höhepunkt in Sachen Errichtung von Erinnerungszeichen erlebte Salzburg 1988. Dies ist vermutlich kein Zufall, bedenkt man, dass sich in diesem Jahr die Republik auf mehreren Ebenen mit ihrer NS-Vergangenheit auseinandersetzte. In diesem von der damaligen SPÖ-ÖVP-Regierung ausgerufenen Bedenkjahr präsentierte eine internationale Historikerkommission die ersten Ergebnisse ihrer Untersuchungen zur Rolle von Bundespräsident Kurt Waldheim in der Wehrmacht. Gleichzeitig wurde zum ersten Mal nach 1945 ein tiefgehender Diskurs über die Verantwortung und Mittäterschaft Österreichs an den Verbrechen des NS-Regimes geführt. Im Bundesland Salzburg enthüllte man in diesem Bedenkjahr acht Erinnerungszeichen für NS-Opfer. Bei diesen handelte es sich in der Stadt Salzburg um Straßenumbenennungen in Gedenken an den Schriftsteller und Exilanten Carl Zuckmayr, die Widerstandskämpferin und Ordensschwester Anna Bertha Königsegg, den Gründer der Israelitischen Kultusgemeinde Dr. Adolf Altmann sowie den Widerstandskämpfer Josef Haidinger. Zugleich wurde im selben Jahr in den Flachgauer Gemeinden Strobl und Eugendorf jeweils eine Gedenktafel für sämtliche Opfer des NS-Terrors sowie im Besonderen für die Opfer der NS-„Euthanasie“ montiert. Darüber hinaus wurde in der Pinzgauer Gemeinde Maria Alm am Steinernen Meer eine Kapelle zu Ehren des Widerstandskämpfers Franz Jägerstätter samt einer Reliquie eingeweiht, im Pongau Gedenktafeln in den Gemeinden Schwarzach und St. Johann enthüllt.
In den Jahren zwischen 1990 und 2000 fand man im Bundesland Salzburg nur wenige Initiativen, die sich der Errichtung von Erinnerungszeichen annahmen. Interessant ist dies insofern, als Österreich in eben diesem Jahrzehnt einer ganzen Reihe prägender und für die Entstehung und Entwicklungen der Zweiten Republik wesentlicher Ereignisse gedachte. So erinnerte man 1995 zum einen an das fünfzigjährige Jubiläum der Kapitulation der Wehrmacht und auch an die Proklamation über die Selbstständigkeit Österreichs, die im April 1945 unterzeichnete wurde. Zum anderen wurde im Mai 1995 das vierzigjährige Jubiläum des Unterzeichnens und Inkrafttretens des Österreichischen Staatsvertrags begangen und nur wenige Monate später an den vierzigsten Jahrestag des Abzugs alliierter Besatzungsmächte aus Österreich erinnert.
Das Jahr 1998 erklärte die SPÖ-ÖVP-Regierung unter Bundeskanzler Viktor Klima erneut zum offiziellen Bedenkjahr. Begangen wurden nicht nur das 80-jährige Jubiläum des Entstehens der Ersten Republik, sondern es fand auch eine Auseinandersetzung mit dem 60 Jahre zuvor stattgefundenen „Anschluss“ Österreichs an Deutschland statt. Im gesamten Bundesland Salzburg wurde in diesem Bedenkjahr lediglich ein Erinnerungszeichen initiiert; es handelte sich hierbei um die Umbenennung der Neuhauser Straße im Salzburger Stadtteil Itzling. Seit 1998 heißt diese Anton-Graf-Straße, benannt nach dem sozialdemokratischen Widerstandskämpfer und späteren Mitglied der Revolutionären Sozialisten Österreichs (RSÖ) Anton Graf, der im Juli 1943 aufgrund seiner antifaschistischen Agitation enthauptet wurde.
Im Jahr 2005 gedachte man unter anderem des 60-jährigen Endes des „Dritten Reichs“. Im Bundesland Salzburg wurden drei Gedenktafeln enthüllt und zwei Straßenumbenennungen vollzogen. Ab 2005 stieg die Zahl der Erinnerungszeichen im gesamten Bundesland an. So wurden 2008 bereits 39 Erinnerungszeichen errichtet, zwischen 2013 und 2016 waren es insgesamt 227. Seither nimmt in Salzburg die Zahl neuer Erinnerungszeichen für Opfer des Nationalsozialismus jedoch stetig ab.
Typen von Erinnerungszeichen
Bundeslandweit machen Stolpersteine drei Viertel der Erinnerungszeichen aus, wobei sich ein überwiegender Teil in der Stadt Salzburg befindet. Verantwortlich für die Salzburger Stolpersteine ist die Plattform „Personenkommittee Stolpersteine“, die das 1996 vom deutschen Künstler Gunter Demnig ins Leben gerufene Projekt am 22. August 2007 nach Salzburg holte, wo in der Landeshauptstadt die ersten Stolpersteine in Gedenken an die 1942 deportierten und ermordeten Ernst, Herbert und Ida Löwy verlegt wurden; am selben Tag verlegte der Künstler neun weitere Stolpersteine in der Stadt. Am 9. September 2024 fand die bisher letzte Verlegung statt. Auch in den Bezirken Flachgau (insgesamt 13 Stolpersteine), Tennengau (35) und Pongau (34) stellen Stolpersteine den größten Anteil an Erinnerungszeichen dar.
Neben Stolpersteinen sind im Bundesland Salzburg Gedenktafeln am zweithäufigsten vorzufinden. Zwischen 1945 und 2024 wurden insgesamt 65 Gedenktafeln enthüllt, wobei sich hier rund die Hälfte (31) aktuell in der Stadt Salzburg befindet, gefolgt von den Bezirken Pinzgau (11), Pongau (9) und Flachgau (8). Die vermutlich erste Gedenktafel für Salzburger Opfer des Nationalsozialismus wurde bereits am 13. März 1948 eingeweiht. Es handelt sich dabei um eine Marmortafel für die Opfer der Exekutive, die zunächst im Foyer der Landespolizeidirektion in der Churfürstenstraße 1 hing. 1985 übersiedelte die Landespolizeidirektion in ein neues Gebäude in der Alpenstraße, wo die Gedenktafel auch heute noch zu finden ist. Sie gedenkt sechs Polizeibeamter, die aufgrund ihrer Verbindungen zum austrofaschistischen Regime von den Nationalsozialisten ermordet wurden.
Häufig vertreten sind weiters Denkmäler, wobei DERLA darunter ein dreidimensional gestaltetes Erinnerungszeichen versteht, das in den meisten Fällen eine Hauptansicht besitzt und auch Schrift als Gestaltungselement enthält. Von insgesamt dreißig Denkmälern befinden sich fast zwei Drittel (18) in der Stadt Salzburg, gefolgt vom Pinzgau (5), dem Flachgau und Tennengau (jeweils 3). Zu den ersten Denkmälern im Bundesland zählten das am 20. Juni 1949 in der Stadt Salzburg eingeweihte Denkmal für sowjetische Kriegsopfer und anderer Nationen am Kommunalfriedhof sowie der nur wenige Tage danach enthüllte Obelisk in Gedenken an 3.709 sowjetische Kriegsgefangene in der Pongauer Gemeinde St. Johann.
Schließlich müssen an dieser Stelle auch Straßen- sowie Wegumbenennungen angesprochen werden, die im Rahmen des Forschungsprojektes insgesamt 42 mal dokumentiert wurden. Zwischen 1945 und 2024 gingen die meisten Umbenennungen (insgesamt 35) in der Stadt Salzburg vonstatten, wobei die Stadt Salzburg zum ersten Mal 1947 den Beschluss fasste, eine Straße im Stadtteil Gnigl nach dem Sozialdemokraten Valentin Aglassinger zu benennen, welcher 1945 im Konzentrationslager Dachau ermordet wurde. Im selben Jahr fiel der Beschluss, eine Straße im Stadtteil Elisabeth-Vorstadt nach dem Eisenbahner und Gewerkschafter August Gruber zu benennen. Gruber leistete Widerstand gegen den Nationalsozialismus, weswegen er nach seiner Verhaftung 1943 hingerichtet wurde.
Opfergruppen
Die 782 Erinnerungszeichen im Bundesland Salzburg gedenken insgesamt 770 Opfer des Nationalsozialismus, deren lebensgeschichtliche Daten für das Personenverzeichnis auf der DERLA-Website erforscht und zusammengetragen wurden. Eine erste Auswertung personenbezogener Daten der 770 NS-Opfer, derer im Bundesland Salzburg gedacht wird, zeigt, dass 64 Prozent (492 Personen) männlich waren. Von den insgesamt 742 Personen, von denen zumindest das Geburtsjahr bekannt ist, wurde rund ein Viertel (195 Personen) zwischen 1900 und 1909 geboren, wobei ein signifikanter Anteil (49 Personen) 1905 zur Welt kam. Zwischen 1890 und 1899 wurden 130 NS-Opfer geboren. Das älteste Salzburger NS-Opfer mit Bezug zu Salzburg war der 1853 in Mainz geborene Jude Victor Mordechai Goldschmidt. Nachdem die Nationalsozialisten 1933 die Macht in Deutschland übernommen hatten, flüchteten er und seine Ehefrau Leontine nach Salzburg. Goldschmidt verstarb 1933 an einem Magendurchbruch, seine Ehefrau nahm sich 1942, vor der geplanten Deportation, das Leben. Das jüngste Salzburger NS-Opfer, das recherchiert wurde, war die in der Stadt Salzburg geborene Antonia Machek, deren Mutter sich während der Geburt aufgrund regimekritischer Äußerungen in Gefangenschaft befand. Antonia Machek verstarb zwei Wochen nach ihrer Geburt in einem Kinderheim in St. Gilgen.
Von insgesamt 688 der 770 im DERLA-Verzeichnis aufgenommenen Personen konnten die Sterbedaten, zumindest das Todesjahr, festgestellt werden. Nur ein Bruchteil dieser (88 Personen) überlebte den Holocaust (Sterbedaten nach 1945), wobei diejenigen, die zwischen der Kapitulation der Wehrmacht und dem Jahresende 1945 starben, hier nicht aufgenommen wurden. Erfasst wurden darüber hinaus vier Personen, deren Sterbedaten vor 1938 liegen. Die Erinnerungszeichen im Bundesland Salzburg gedenken also 596 Menschen, die die Nationalsozialisten zwischen 1938 und 1945 ermordeten. Die Zahl der Opfer steigt ab ca. 1940 signifikant an und erreicht 1941 mit 212 Toten (rund 36 Prozent) ihren Höhepunkt.
Von den im DERLA-Personenverzeichnis aufgenommenen Personen fiel rund ein Drittel (229 Ermordete) der NS-„Euthanasie“ zum Opfer, gefolgt von Salzburger Juden und Jüdinnen mit insgesamt 158 Ermordeten. Die drittgrößte Gruppe stellen mit 16 Prozent Widerstandskämpfer*innen dar, die sich aufgrund ihrer politischen Überzeugung antifaschistisch betätigten und ermordet wurden, wobei der größte Teil dieser Ermordeten einem kommunistischen, sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Milieu entstammt. Nicht unwesentlich erscheint aber auch der religiöse Widerstand; hierbei handelt es sich um Priester, die gegen das NS-Regime aufbegehrten, sowie um Zeugen Jehovas, die den Wehrdienst verweigerten. Nicht explizit angeführt sind aktuell noch Menschen, die als „Asoziale“ galten; hierfür gibt es bis dato keine eigene Kategorie, sondern diese wird nun als ein Ergebnis des Salzburger Projekts nachträglich für DERLA eingeführt.
Resümee und Ausblick
Das Forschungsprojekt hat aufgezeigt, dass ein umfassender Teil der 782 Salzburger Erinnerungszeichen erst ab dem Jahr 2000 errichtet wurden, wobei 2016 ein vorläufiger Höhepunkt erreicht wurde. Seither nehmen die Initiativen sukzessive ab. Insgesamt befinden sich mit 77 Prozent die meisten Erinnerungszeichen in der Stadt Salzburg, der Bezirk Lungau verzeichnet aktuell (Stand: Jänner 2025) die wenigsten Gedenkzeichen für die Opfer des Nationalsozialismus. Die Projektmitarbeiter*innen haben insgesamt 770 Opferbiografien dokumentiert. Unter den von den Nationalsozialisten verfolgten Gruppen stellen die Opfer der NS-„Euthanasie“ im Bundesland Salzburg die Gruppe dar, derer auf Erinnerungszeichen am häufigsten namentlich gedacht wird (229 Ermordete). Auch verfolgte und ermordete Jüdinnen und Juden (158) sowie Widerstandskämpfer (119) werden häufig mit Namen genannt auf den Erinnerungszeichen.
Die Erinnerungszeichen für NS-Opfer im Bundesland Salzburg wurden erstmals vollständig erfasst. Angesichts des Ablebens zahlreicher Zeitzeug*innen, mit denen Berichte über die NS-Zeit für immer verstummen, erscheint es essenziell, eine wissenschaftlich fundierte und regelmäßig aktualisierte Plattform zu bieten, die nachkommenden Generationen die Möglichkeit gibt, sich über lokale Aspekte des Nationalsozialismus sowie des Umgangs mit seinen Verbrechen nach 1945 zu informieren. DERLA ist somit jetzt bereits zu einem wesentlichen Bestandteil regionaler Erinnerungskultur geworden.
Projektpräsentation
DERLA Salzburg wurde am 27. Jänner 2025 offiziell präsentiert. Bei der gut besuchten Veranstaltung im Gebäude der Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät sprachen zunächst mehrere Ehrengäste, darunter der Bürgermeister der Stadt Salzburg, Bernhard Auinger, bevor das Projektteam Highlights der Salzburger Forschungsergebnisse präsentierte.
Zuordnung
- Kategorien
- Lernmaterial
- Themen
- Antisemitismus Gedenkstätte/Erinnerungsort Holocaust/Shoah Widerstand Zwangsarbeit Verfolgte des Nationalsozialismus Euthanasie
- Medium
- Digitales Lernangebot
- Region/Bundesland
- Salzburg